„Die Lösung wird zum Problem!“
Sie haben dazu geforscht, warum die Digitalisierung so erfolgreich Fuß gefasst hat. Und zwar in einem Tempo, dass viele die Entwicklung so empfinden, als wäre eine Kolonialmacht über uns gekommen, derer wir uns irgendwie erwehren müssen. Ihre These dazu lautet, dass die Gesellschaft schon vorher digital war. Heißt das, die Technik hat sich auf etwas draufgesetzt, was schon da war?
Wahrscheinlich kann man sagen, dass sich neue Techniken immer auf etwas draufsetzen. Denn es werden sich Technologien nur durchsetzen, insoweit sie einen Nerv der Gesellschaft treffen. Die Dampfmaschine beispielsweise konnte sich nur durchsetzen, weil Kraftentfaltung anschlussfähig war. Dadurch hat sie Kraftentfaltung ermöglicht und potenziert. Sonst hätte man mit der Dampfmaschine nichts anfangen können. Mit einer Zeitung, um auf den Medienbereich zu schauen, kann man erst etwas anfangen, wenn es Gesellschaften gibt, in denen man öffentliche Diskurse führen kann, die dann dadurch entstehen.
Der Computer macht ja zunächst nichts anderes, als in Datensätzen Muster zu erkennen, sie miteinander zu verknüpfen ...
Was für ein Problem löst dann die Digitalisierung? Mit der Entstehung der modernen Welt, von Nationalstaaten, von politischen Räumen, dem Betriebskapitalismus, der Wissenschaft, einer starken Form von Verwaltung und Sozialplanung ist eine Idee von Mustererkennung entstanden. Das ging bereits im 19. Jahrhundert los. Man hat nicht mehr von der Hand in den Mund gelebt, nicht mehr Lösungen für Probleme direkt aus der Praxis entworfen, sondern man hat Muster entdeckt und berechnet, was man braucht.
Das ähnelt schon dem, was die Digitaltechnik im 20. Jahrhundert professionalisiert hat. Der Computer macht ja zunächst nichts anderes, als in Datensätzen Muster zu erkennen, sie miteinander zu verknüpfen, signifikante Formen von Zusammenhängen zu entbergen – und das rein quantitativ, in einem Leistungsbereich, an den unser Bewusstsein gar nicht mehr herankommt.
Das war der Erfolg dieser Technik, die dann tatsächlich, Ihre Formulierung hat mir gut gefallen, wie ein Kolonialist von außen in die Gesellschaft hineinkam. Man konnte ganz offensichtlich in unterschiedlichsten Bereichen mit dieser Technik der Mustererkennung als zweite Form der Steuerung umgehen. Und dann kam als Drittes hinzu, dass es sich um ein Medium handelt, das tatsächlich die Medienwelt total durcheinandergebracht hat.
Digital bedeutet 1/0, also etwas Binäres. Ab wann war die Gesellschaft denn digital?
Die Gesellschaft war nicht digital in dem Sinne, dass man alles auf 1 und 0 zurückführen kann, sondern sie war insofern digital, dass man mithilfe von einfachen Berechnungsmethoden das Inkommensurable kommensurabel machen konnte. Man konnte Dinge miteinander vergleichen, die man im ersten Moment nicht miteinander vergleicht. Das ist eigentlich das Digitale. Das ist das Tolle an Datensätzen, dass man mit ihnen Dinge machen kann, die in den Intentionen derer, die die Daten hervorbringen, vorher nicht da gewesen sein mussten.
Das ganze Geschäftsmodell der sozialen Medien beruht genau darauf. Die Anbieter interessieren sich viel weniger dafür, wer da mit wem kommuniziert, sondern dass dadurch Daten anfallen, deren Muster man für etwas anderes, vor allem für ökonomischen Mehrwert verwenden kann.
0 und 1 ist insofern spannend, als dass es die simpelste Form der Unterscheidung ist. Ich habe versucht, das mit der Schrift zu vergleichen – diese braucht immerhin 26-mal zwei Zeichen, um fast alles bezeichnen zu können. Die digitale Zeichenwelt braucht eigentlich nur zwei Zeichen. Deshalb ist sie im Grunde für alle Bereiche anwendbar. Diese Simplizität des Mediums ermöglicht die Komplexität dessen, was man damit betreiben will.
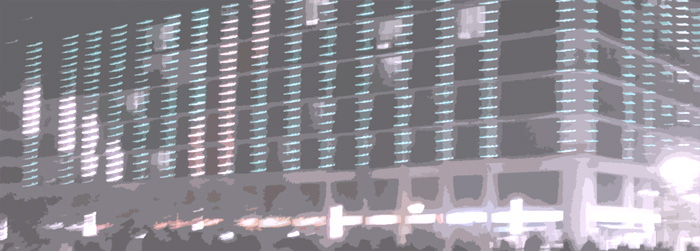
Es wird also ein Mehrwert geschaffen, die Technik löst ein Problem der Gesellschaft. Warum ist es so wichtig, den Sachverhalt der Digitalisierung unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten? Sie haben in Ihrem Buch moniert, dass die Sozialwissenschaften hier in ihrer Kritik der Digitalisierung an der Oberfläche bleiben …
Na ja, nicht an der Oberfläche; es ist einfach eine andere Frage, die mich interessierte. Mich interessierte zunächst nicht, was das für eine Art von Störung ist, sondern warum ist das eine Technik, die so erfolgreich ist?
Eine Gesellschaftstheorie der Digitalisierung gab es in der Form vorher noch nicht. Und ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, zu wissen, warum diese Technik in der Lage ist, in fast allen Bereichen der Gesellschaft anschlussfähig zu sein. Erst im zweiten Schritt wird dann deutlich, welche Bedeutung und Folgen diese Art von Technik für gesellschaftliche Routinen, Prozesse und natürlich auch Formen gesellschaftlicher Regulierung hat.
Das ist interessant, denn Ihre These lautet: Digitalisierung bedeutet nicht Disruption, sondern das Gegenteil. Tatsächlich aber empfinden wir es alle als Disruption. Wir denken, dass alles umgeworfen wird durch die Digitalisierung. Sie schreiben hingegen, das verweise auf die merkwürdige Stabilität des gesellschaftlichen Gegenstandes.
Wir nehmen schon richtig wahr, dass sich sehr viel verändert. Allerdings nutzt Digitaltechnik die Trägheit der Gesellschaft. Wenn man sich einmal überlegt, was man mit großen Datensätzen machen kann, dann sucht man eigentlich nach Regelmäßigkeiten, die stabiler sind als das, was wir so sehen.
Wenn Sie etwa mit einem Datensatz Marketing oder Produktentwicklung betreiben wollen, dann suchen Sie in den Datensätzen nach Regelmäßigkeiten, um daraus etwas zu lernen. Techniktools versuchen sozusagen, von einer Situation auf die andere zu schließen. Digitaltechnik nutzt relativ stabile Muster, um z.B. Prognosen machen zu können. Das ist dem, was Sozialwissenschaften machen, sehr ähnlich. Wir leben z.B. gerade in der Coronakrise und denken, dass alles anders wird. Stattdessen stellen wir fest, dass die Gesellschaft nach ziemlich festgelegten Mustern auf diese Krise reagiert.
Worauf es mir ankommt, und das ist auch für das Medienthema sehr wichtig, ist, dass man dabei eine starke Kontinuität wahrnehmen kann. Medien sind etwas vergleichsweise Simples. Sie wollen letztlich nichts anderes tun, als mit Informationen Anschlussfähigkeit herzustellen. Und jetzt passiert das in einem völlig neuen Medium, in dem sich aufgrund dieser Vereinfachung alle Verheißungen, die es vorher gab, erfüllen: Der Mensch darf überall alles sagen und sollte überall gehört werden. Das ist erfüllt und produziert gleichzeitig neue Probleme.
Das ist eine schöne Parabel darauf, dass eine einfache Struktur, eine einfache Form Probleme generiert, die erst dadurch entstehen, dass man dieses Medium nutzt. Die Lösung wird zum Problem. Das ist im Übrigen das, was die moderne Gesellschaft überall ausmacht.
Das heißt, der Eindruck, dass sich viel verändert, ist nicht falsch. Aber es verändert sich auf der Basis von etwas vergleichsweise Stabilem.
Das bringt uns zu einem soziologischen Begriff: Während wir vorher einen Kritiküberschuss hatten, führt das Digitale zu einem Kontrollüberschuss, mit dem die Gesellschaft klarkommen muss. Kontrolle wird zur bestimmenden Produktivkraft – technisch und sozial. Was heißt das genau?
Das ist eine Unterscheidung, die nicht von mir stammt, sondern von dem Soziologen Dirk Baecker. Der Kritiküberschuss wäre das, was man mit der Buchdruck-Welt verbindet. Seit es den Buchdruck gab, hat es immer wieder Kritik gegeben an dem, was geschrieben war. Jedes neue Buch war im Prinzip Kritik an den Büchern vorher.
Der Kontrollüberschuss bedeutet, dass wir jetzt auf einmal Mittel in der Hand halten – wir: Wer ist das eigentlich? Das ist sehr ungleich verteilt, wer das in der Hand hält –, mit denen wir über Mustererkennung und das Abscannen von Prozessen Informationen generieren können, mit denen sich Prozesse stark steuern lassen.
Die Frage der Regulierung von Medien ist ja auch nichts anderes als der Versuch, festzulegen, wer über wen die Kontrolle ausübt.
Das ist ein Kontrollüberschuss: dass erfolgreiche Digitaltechnik es ermöglicht, Prozesse zu kontrollieren und zu steuern. Dieser Kontrollüberschuss ist es ja, der uns die großen Sorgen über diese Technik macht. Wir benutzen ganz simpel irgendwelche Smartphones und stellen gleichzeitig fest, dass man dabei Datenspuren hinterlässt, mit denen andere einen Kontrollüberschuss über einen selbst haben können.
Für diesen Kontrollüberschuss brauchen wir neue kulturelle Formen. Die Frage der Regulierung von Medien ist ja auch nichts anderes als der Versuch, festzulegen, wer über wen die Kontrolle ausübt. Wir haben in Deutschland noch ein starkes subsidiäres Prinzip – wir verlagern die Kontrolle quasi von oben nach unten. Jetzt haben wir es mit einem Medium zu tun, das den Kontrollüberschuss so stark macht, dass man womöglich mit diesen subsidiären Formen nicht mehr auskommt. Das ist eine schwierige Situation, und das ist ein Beispiel für Disruption. Da ändert sich durch die Anwendung der Technik etwas in unserem Selbstverständnis.

Wir haben also mehr zu kontrollieren, als wir eigentlich können?
Das ist eine schöne Formulierung, weil es die ganze Paradoxie auf den Begriff bringt. Wir haben die Mittel, in Prozesse einzugreifen, und brauchen diese Mittel, um bestimmte Steuerungsprozesse möglich zu machen und müssen gleichzeitig mithilfe von Steuerungsmitteln diese Steuerungsmittel auch in ihre Schranken verweisen. Das ist unglaublich kompliziert.
Das Tolle ist ja gerade bei der Mediensteuerung, dass man die Steuerungsmittel braucht, um herauszufinden, welche Muster in ganz bestimmten Formen entstehen, die man z.B. unterbinden will. Um bestimmte Inhalte oder bestimmte Formen der Überhitzung durch das Medium wahrzunehmen, brauchen wir wiederum auch die Technik.
Ich würde sagen, dass das Paradoxe an der Digitalisierung ist, dass Digitalisierungsprozesse bisweilen Orientierungslosigkeit, Instabilitäten, Disruptionen produzieren, dass wir gleichzeitig aber die Digitaltechnik brauchen, um diese Folgen wieder zu bearbeiten. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Technik aus dieser Gesellschaft tatsächlich nicht mehr wegzudenken ist.
Sie schreiben, die Digitalisierung führe zur Störung der Routinen der Moderne. Ein Stichwort sei Monopolbildung. Welche Beispiele können Sie noch nennen?
Eine der größten Störungen, die wir haben, ist, dass die Produktion von Wertschöpfung durch die Digitalisierung von Wirtschaftsprozessen immer weniger Personen zugerechnet werden kann. Da entstehen völlig neue Machtpositionen! Damit werden sich diese und die nächste Generation ziemlich herumschlagen müssen. Im Medienbereich haben wir die Störung, dass man auf alles zugreifen kann und Gatekeeper verschwinden. Deshalb bekommt man besonders viele Informationen, aber es ist besonders schwer herauszufinden, welche valide sind. Die Liste könnte man unendlich erweitern.
Mir fällt noch ein Beispiel ein – Algorithmen, die uns dadurch herausfordern, dass sie keine Unschärfe zulassen im Gegensatz zu uns Menschen, die ja immer noch ein wenig Spielraum in ihren Entscheidungen haben.
Ein Algorithmus ist zunächst etwas ganz Simples. Das ist ein Konditionalprogramm – es wirkt komplex und vermittelt den Eindruck, als würde es etwas „selbst machen“. Eigentlich wird ein Algorithmus ja programmiert, unter bestimmten Bedingungen dieses oder jenes zu tun.
Schwierig wird es, wenn wir es mit Techniken zu tun haben, die selbst Entscheidungen treffen oder denen wir Entscheidungen zurechnen. Man muss sich fragen: Wem rechnet man zu, dass etwas geschieht? Mein Lieblingsbeispiel ist das selbstfahrende Auto. Hier haben wir eine Technik, die mithilfe von Sensoren in der Welt Strukturen entdeckt und dann aufgrund dieser Daten Entscheidungen trifft. Wenn solch ein Apparat einen Fehler macht, dann kann man nicht sagen, dass so etwas wie „menschliches Versagen“ vorlag. Diese Kontingenzformel steht uns nicht zur Verfügung! Denn es ist nur ein Algorithmus, nur eine künstliche Intelligenz.
Das ist eine Frage, mit der sich unsere Kultur auseinandersetzen muss, welche Art von Zurechnungsfähigkeit man hier sowohl rechtlich als auch moralisch als auch im Alltag denken kann.
Die Digitalisierung sprengt die Grenzen der Funktionssysteme. Sie fordere, so schreiben Sie, institutionalisierte Routinen heraus. Welche neuen Routinen brauchen wir?
Ich habe ja gerade das Beispiel genannt: Wie gehen wir rechtlich damit um, wenn wir einer Technik etwas zurechnen und nicht mehr juristischen Personen, die Organisationen oder Menschen sein können? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, mit der wir nicht erst in ferner Zukunft, sondern heute schon zu tun haben. Wenn Sie an einem Beatmungsgerät hängen, dann hat das Beatmungsgerät selbst eine Steuerung, die z.T. auf die Veränderung der unmittelbaren Situation reagiert. Die spannende Frage ist: Welche Rolle hat derjenige, der den Apparat bedient, in einer Welt, in der der Apparat selbst Entscheidungen trifft?
Man sieht, das Rechtssystem muss sich an Dinge anpassen, die technisch nun möglich sind. Das ist ein Lernprozess. Wir sehen unterschiedliche Formen, damit umzugehen. Es gibt Laissez-faire-Formen, Formen, in denen man staatlich sehr stark oder geradezu autoritär reguliert. Und es gibt Formen, in denen man versucht, einen Ausgleich zu finden. Vor allem aber gibt es eine Form nicht: auf diese ganze Technologie verzichten zu können. Das ist inzwischen unmöglich. Es gibt vielleicht ein paar Lebensformen, in denen das möglich ist. Aber diese Menschen, die so leben können, sind sehr privilegiert, weil sie dann andere haben, die für sie mit diesen Apparaten umgehen.
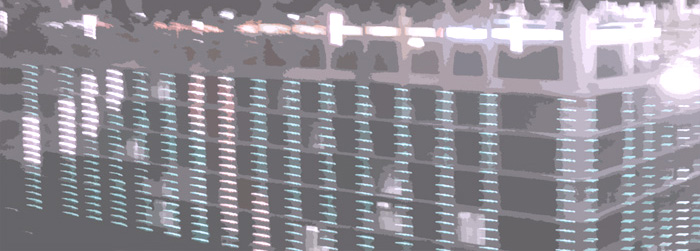
Jede Regulierung – auch Medienregulierung – bezieht sich auf eine Gemeinschaft. Inwiefern können wir heute noch von einer Gemeinschaft sprechen? Es gibt Stimmen, die sagen, dass sich die Gesellschaft in Parallelwelten ausdifferenziert. Wie sehen Sie das?
Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage … Wenn wir zurückblicken: Funktionale Differenzierungsprozesse gibt es seit 250 Jahren. Das Interessante ist, dass wir immer versucht haben, diese Perspektivendifferenz zu überwinden. Der Nationalstaat war z.B. so ein Versuch – mit all seinen positiven und negativen Folgen. Die Nation war im 19. Jahrhundert eine emanzipatorische Bewegung und gleichzeitig auch eine exkludierende. Jetzt leben wir in einer globalisierten Welt, in der wir feststellen, dass wir die Folgen der Digitalisierung nicht im nationalstaatlichen Rahmen bewältigen können. Schon deshalb nicht, weil die Netzwerkfolgen natürlich global sind. Das ist aber auch nichts Neues.
Das Schlimmste, was es gibt, sind einfache Formeln für komplexe Probleme. Die funktionieren einfach nicht. Wir hätten das gern. Wir hätten gern, dass wir das Coronavirus mit einfachen Lösungen loswerden. Aber wir stellen fest, wie komplex es ist; hier Steuerungen vorzunehmen, das Verhalten der Menschen, die Funktionssysteme wie Ökonomie und Politik und Bildung dazu zu bringen, die Infektionszahlen zu senken. Ein Appell an die Vernunft oder starke Formen von autoritärer Herrschaft sind zu einfache Lösungen und funktionieren nicht. Wir müssen also unsere Eigenkomplexität aufbauen, was bedeutet, dass wir mit den unterschiedlichen Perspektiven auf ein Problem rechnen müssen. Das gilt auch für die Folgen der Digitalisierung. Das macht einen öffentlichen Diskurs schwieriger. Man kann nicht zu jedem Problem ein soziologisches Hauptseminar in der Öffentlichkeit machen. Man kann mit solchen Sätzen auch nicht gewählt werden, und in den Medien funktioniert das auch nicht immer. Ganz davon abgesehen, dass das soziologische Hauptseminar die Probleme auch nicht lösen würde (lacht).
Brechen wir es herunter auf Inhalte-Regulierung im Netz. Ein Gegensatzpaar lautet hier: mehr Staat versus mehr Selbstregulierung. Wie kann das gehen?
Das ist die zweite Eine-Million-Dollar-Frage. Wenn man auf die Geschichte des Mediensystems schaut, würde man sagen, dass die große Verheißung war, möglichst wenig zu regulieren. Das Problem der Medien am Anfang war das der Zensur.
Mittlerweile können die Medien alles melden, was möglich ist – das Recht besteht ja auch darin, Unsinn zu schreiben. Das ist Freiheit. Die strukturelle Selbstbegrenzung des Systems über die Gatekeeper ist weggefallen. Deshalb ist es nun sehr schwierig, entsprechend anzusetzen.
Das Schlimmste, was es gibt, sind einfache Formeln für komplexe Probleme. Die funktionieren einfach nicht.
Man könnte sagen, wir nehmen das wirklich ernst mit der Liberalität: Jeder darf sagen, was er will. Die Folgen müssen dann entsprechend bearbeitet werden. Oder man macht es autoritär. Man könnte mithilfe von Algorithmen bestimmte Begriffe aufstöbern und die Leute dann aus den sozialen Medien entfernen. Wahrscheinlich ist der Mittelweg der einzig mögliche.
Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber vielleicht benötigen wir andere Institutionen zur Lösung des Problems. Und wir brauchen darüber einen öffentlichen Diskurs, der zunächst einmal einem größeren Publikum klarmacht, was an dieser Medienform anders ist als an den traditionellen Medien. Ich glaube, dass das teilweise gar nicht so bekannt ist.
Wie viel Regulierung soll der Staat im Hinblick auf technischen Fortschritt ausüben? Das ist eine weitere Grundfrage der Moderne. Die einen sagen, am besten hat der Staat das selbst in der Hand, als wäre der Staat derjenige Akteur, der besser weiß, wie diese Geschichten gehen. Ich habe da große Zweifel. Wahrscheinlich brauchen wir tatsächlich Foren, in denen man darüber nachdenkt, welche Art von Technik wo tatsächlich sinnvoll einsetzbar ist. Ich würde mir von staatlichen Akteuren wünschen, dass sie zugeben, dass wir es in der nächsten Generation mit disruptiven Veränderungen im Arbeits- und Medienleben und auch im Privatleben zu tun haben werden.
Aber wenn ich an zurückliegende Wahlkämpfe denke: Da war zuletzt das einzige digitale Thema die Frage, ob man Glasfaserkabel auch bis Niederbayern verlegen kann oder nicht. Das ist die Steinzeitfrage zur Digitalisierung!
Anmerkung:
* Das Interview entstand im Rahmen der medien impuls-Tagung Zwischen Government und Governance: MedienRegulierung 2020 im Dezember 2020 und wurde für diesen Abdruck leicht überarbeitet

Armin Nassehi (Foto: Hans-Günther Kaufmann)
Dr. Armin Nassehi ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Vera Linß (Foto: Jörg Wagner)
Vera Linß ist Medienjournalistin und Moderatorin.
