Medien, Glück und Wohlbefinden
Um sinnvoll über die Auswirkungen von Mediennutzung sprechen zu können, ist es wichtig, zunächst ein zentrales Konzept zu klären: Glück. Statt von Glück wird in der psychologischen Forschung zumeist von „Wohlbefinden“ (Well-Being) gesprochen. Daher verwenden wir im Folgenden diesen Begriff. Unter Wohlbefinden ist dabei ein Zustand hoher Lebenszufriedenheit gepaart mit häufig auftretenden positiven und selten auftretenden negativen Stimmungen und Gefühlen zu verstehen (Martela/Sheldon 2019). Zum Wohlbefinden einer Person tragen zahlreiche verschiedene Faktoren bei, beispielsweise ihre sozialen Beziehungen, ihre eigene Gesundheit und Arbeitssituation, persönlicher Besitz oder auch demografische Faktoren. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass Medien und Mediennutzung im Allgemeinen keinen überwältigenden, vielleicht sogar einen eher kleinen Beitrag zu diesem komplexen Gesamtgefüge leisten.
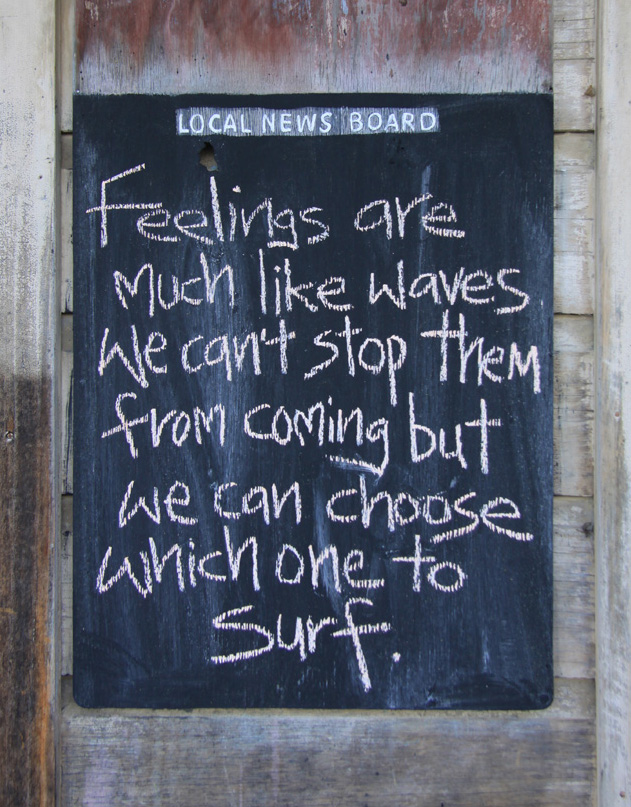
Dieser – dennoch nicht zu unterschätzende – Beitrag soll hier in zwei Schritten genauer unter die Lupe genommen werden. In einem ersten Schritt geht es darum, noch etwas besser zu verstehen, was genau Menschen eigentlich suchen, wenn sie sich von Medien unterhalten lassen. Denn wenn es ihnen wirklich nur um die Maximierung positiver Gefühlszustände zu tun wäre, wie ließe sich dann erklären, dass sich Menschen auch traurige Filme ansehen, die sie zutiefst aufwühlen? In einem zweiten Schritt widmen wir uns den aktuellen Diskussionen um die möglichen Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien auf das Wohlbefinden.
Unterhaltung durch Medien
Eine Art und Weise, wie Medien zu Wohlbefinden beitragen, ist, dass sie Menschen unterhalten. Doch was bedeutet es eigentlich, sich unterhalten zu fühlen? Frühe Forschungsansätze verstanden Unterhaltungserleben als gleichbedeutend mit Spaß oder Vergnügen. Die Zuwendung zu unterhaltsamen Medieninhalten wurde beispielsweise als eine Flucht aus dem Alltag (Eskapismus) erklärt. Die von Dolf Zillmann geprägte Mood-Management-Theorie geht zudem davon aus, dass Menschen Medieninhalte auswählen, um ihre Stimmung zu verbessern bzw. eine positive Stimmung aufrechtzuerhalten. Obwohl die Annahmen der Theorie empirisch gut belegt sind, hat ihre Erklärungskraft Grenzen. Denn das Erlebnis, das die meisten Menschen beim Anschauen von Filmen wie Schindlers Liste empfinden, lässt sich wohl kaum treffend als Spaß oder Vergnügen umschreiben. Dennoch üben derartig emotional herausfordernde Geschichten einen Reiz aus, indem sie ihr Publikum bewegen und zum Nachdenken anregen. Diese Beobachtung führte in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Paradigmenwechsel: Das traditionell hedonische Verständnis von Unterhaltung als Vergnügen (Enjoyment) wurde um eine zweite komplexere Dimension ergänzt, die das Gefühl von Wertschätzung (Appreciation) beschreibt, das Menschen oft infolge von ergreifenden Geschichten empfinden.
Diese Dimensionen des Unterhaltungserlebens wurden von Mary Beth Oliver und Kolleg:innen vor dem Hintergrund der antiken philosophischen Unterscheidung zwischen hedonischem und eudaimonischem Glück konzeptualisiert (siehe z. B. Oliver/Bartsch 2010). Einerseits kann die Zuwendung zu hedonischen Unterhaltungsmedien zu subjektivem Wohlbefinden beitragen, d. h. dabei helfen, die Stimmung zu regulieren und sich unmittelbar besser zu fühlen. Für eine gelungene Lebensführung ist nach der aristotelischen Auffassung allerdings das eudaimonische Glück unentbehrlich, das sich aus einem Gefühl von Sinnstiftung und Erkenntnisgewinn ergibt. Dementsprechend wird Appreciation als eudaimonische Form des Unterhaltungserlebens verstanden, für die positive Effekte auf psychologisches Wohlbefinden angenommen werden. Dieses entsteht beispielsweise aus persönlichem Wachstum, Einsichten und erfüllten Bedürfnissen nach sozialer Verbundenheit, Kompetenz und Autonomie. Ein bewegender Film, ein inspirierendes Buch oder eine Dokumentation, die zum Nachdenken anregt, haben also das Potenzial, eine Quelle von eudaimonischem Glück zu sein.
Besonderes Interesse von Forscher:innen, die sich mit eudaimonischem Unterhaltungserleben befassen, haben sogenannte selbst-transzendente Emotionen geweckt, da diese mit prosozialen Wirkungen (wie etwa einem Gefühl von Verbundenheit mit der Menschheit oder dem Abbau von Vorurteilen) in Verbindung gebracht werden. Diese zählen zu den komplexen Emotionen, die für das Erleben von Appreciation charakteristisch sind und häufig durch Medieninhalte ausgelöst werden, z. B. Ehrfurcht, Mitgefühl oder Inspiration. Selbst-Transzendenz bedeutet, dass die Aufmerksamkeit sich weg von den eigenen, alltäglichen Belangen und hin zu Dingen richtet, die größer sind als das Selbst (Oliver u. a. 2021).
Menschen suchen in Unterhaltungsmedien weit mehr als nach einer Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltag – sie suchen nach komplex-emotionalen Erfahrungen.
Die Feststellung, dass Medien uns unterhalten, ist also keineswegs so trivial, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Menschen suchen in Unterhaltungsmedien weit mehr als nach einer Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltag – sie suchen auch nach komplex-emotionalen Erfahrungen und Erkenntnisgewinn, die einen wichtigen Baustein für menschliches Wohlbefinden darstellen. Im nächsten Abschnitt widmen wir uns der viel diskutierten Frage, welchen Einfluss die Nutzung sozialer Medien auf das Wohlbefinden haben kann.
Soziale Medien und Wohlbefinden: mögliche Wirkmechanismen
In populärwissenschaftlichen Beiträgen und im gesellschaftlichen Diskurs wird oft nahegelegt, dass die Nutzung sozialer Medien (z. B. Instagram, Facebook, Snapchat) zu weniger Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden führt. Auch aus wissenschaftlicher Sicht wurden Argumentationslinien vorgebracht, die die Nutzung sozialer Medien mit einem geringeren Wohlbefinden in Verbindung bringen.
Erstens könnte die Kommunikation über soziale Medien ein Ersatz für die wertvolle Zeit sein, die für persönliche Kommunikation aufgewendet wird. Dieser Argumentation zufolge bietet die Kommunikation über soziale Medien nicht den gleichen Nutzen für das Wohlbefinden wie persönliche Begegnungen, da es ersteren angeblich an Qualität und Tiefe mangelt (Yang u. a. 2014). Folglich sollte eine intensivere Nutzung von sozialen Medien zu einem geringeren Wohlbefinden führen.
Zweitens bieten soziale Medien reichlich Gelegenheit für soziale Vergleiche. Nutzer:innen können sich mit Peers oder Influencer:innen auf Dimensionen vergleichen, die für den Selbstwert relevant sind, wie Attraktivität oder soziale Verbundenheit. Unter sonst gleichen Bedingungen neigen Individuen dazu, soziale Vergleiche mit besonders schönen und erfolgreichen Personen anzustellen (Aufwärtsvergleiche). Solche Aufwärtsvergleiche sind tendenziell mit reduziertem Wohlbefinden assoziiert. Da sich Menschen in den sozialen Medien von ihrer besten Seite zu zeigen versuchen (z. B. indem sie sehr schmeichelhafte oder mit Filtern bearbeitete Bilder der eigenen Person auswählen), sollte die Intensität der Nutzung von sozialen Medien mit einem geringeren Wohlbefinden zusammenhängen.
Drittens erhöht eine intensive Nutzung von sozialen Medien die Wahrscheinlichkeit, stark selbstwertgefährdenden Formen von Onlinekommunikation wie Cyberbullying (Cybermobbing), Grooming durch Fremde und nicht konsensuellem Sexting ausgesetzt zu sein bzw. daran teilzunehmen. Opfer (und Täter) von Cyberbullying zu sein, wurde vielfach mit einem geringeren Wohlbefinden in Verbindung gebracht (z. B. Kowalski u. a. 2014).
Soziale Medien bieten zusätzliche Spielräume für die kontrollierte Gestaltung sozialer Begegnungen.
Gleichzeitig lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht jedoch auch für die gegenteilige Perspektive argumentieren, also für die Annahme, dass die Nutzung sozialer Medien mit höherem Wohlbefinden zusammenhängt. Erstens können Kontakte in sozialen Medien wertvoll sein, da sie Sozialkapital bereitstellen (Ellison u. a. 2007): Das heißt, sie helfen dabei, ein Netzwerk mit anderen Personen zu knüpfen, das persönliche oder fachliche Ressourcen anbietet. Zweitens ist das in sozialen Medien erhaltene Feedback häufig positiv (z. B. gibt es bei Facebook keinen Dislike-Button) und positives Feedback steht in einem Zusammenhang mit höherem Wohlbefinden.
Drittens bieten soziale Medien zusätzliche Spielräume für die kontrollierte Gestaltung sozialer Begegnungen: So kann man sich etwa mehr Zeit lassen, ehe man auf eine Nachricht reagiert, oder gezielter überlegen, wie man sich selbst präsentieren möchte, als dies in der Face-to-Face-Kommunikation möglich ist. Eine solch verbesserte Selbstpräsentation und Selbstdarstellung werden wiederum mit einem höheren Wohlbefinden in Verbindung gebracht.
Soziale Medien und Wohlbefinden: empirische Evidenz
Abgesehen von diesen theoretischen Überlegungen stellt sich selbstredend die Frage, wie sich der Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und Wohlbefinden empirisch darstellt. Auch hier ist das Bild vielschichtig. In querschnittlichen Studien werden Personen zu einem Messzeitpunkt bezüglich ihrer Social-Media-Nutzung und ihres Wohlbefindens befragt; diese Maße werden dann statistisch in Zusammenhang gebracht. Diese Zusammenhänge sagen jedoch nichts über die Wirkrichtung aus. Das bedeutet, dass keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob die Nutzung sozialer Medien dazu führt, dass es Personen schlechter geht, oder ob vielleicht doch umgekehrt Menschen, denen es aus anderen Gründen schlechter geht, verstärkt soziale Medien nutzen. Möglich ist auch, dass beide Wirkungen gleichzeitig vorliegen. In den letzten Jahren wurden sehr viele solcher Studien durchgeführt; auch wurden bereits einige Metaanalysen dazu publiziert (im Überblick: Appel u. a. 2020). In diesen Metaanalysen zeigen sich sehr kleine Zusammenhänge. Die Tendenz ist dahin gehend, dass Personen, die mehr Zeit auf sozialen Netzwerkseiten verbringen, auch etwas niedrigere Werte beim Wohlbefinden und der Lebenszufriedenheit berichten. All diese Zusammenhänge sind zwar statistisch signifikant, jedoch sehr klein und abhängig davon, wie Forscher:innen methodisch vorgehen.
Im Hinblick auf die Wirkrichtung aussagekräftiger sind Längsschnittstudien. In diesen Studien werden Personen über einen längeren Zeitraum von Tagen, Wochen, mehreren Monaten oder gar Jahren untersucht. In Studien zu dem Themenbereich werden dabei mehrmals, zu verschiedenen Messzeitpunkten, Maße der Social-Media-Nutzung einerseits und Maße des Wohlbefindens andererseits erhoben. Eine Studie auf Basis einer repräsentativen Stichprobe deutscher Jugendlicher, die über neun Jahre hinweg beobachtet wurden, ist aufgrund ihrer hohen Datenqualität besonders aufschlussreich (Schemer u. a. 2021). Die Studie zeigt, dass die Häufigkeit der Internetnutzung im Allgemeinen sowie der Nutzung sozialer Netzwerkseiten im Besonderen für das subjektive Wohlbefinden von Jugendlichen langfristig weder schädlich noch förderlich ist. Dies trifft gleichermaßen auf Maße des aktuellen Wohlbefindens, selbstberichtete depressive Tendenzen und die allgemeine Lebenszufriedenheit zu. Es gibt aber auch längsschnittliche Befunde, die mögliche negative Effekte von Social-Media-Nutzung auf bestimmte Aspekte des Wohlbefindens beschreiben, wie etwa einen reduzierten Selbstwert oder verringerte psychische Gesundheit.
In Experimenten zum Thema „Social Media und Wohlbefinden“ wird typischerweise die eine Hälfte der Teilnehmer:innen gebeten, auf die Nutzung sozialer Medien für eine bestimmte Zeit zu verzichten (die Experimentalgruppe), während die andere Hälfte (die Kontrollgruppe) soziale Medien wie gewohnt nutzt. Eine solche Studie zeigte, dass die Teilnehmer:innen der Experimentalgruppe (fünf Tage lang Verzicht auf Facebook) einen niedrigeren Cortisolspiegel – als Indikator für Stress – aufwiesen. Sie berichteten im Mittel jedoch auch eine geringere Lebenszufriedenheit (Vanman u. a. 2018). In einer anderen besonders umfangreichen Untersuchung wiederum zeigte sich, dass das Deaktivieren von Facebook für vier Wochen zu einer geringfügigen Steigerung des retrospektiv gemessenen Wohlbefindens führte – es gab jedoch keine Veränderungen beim momentanen Wohlbefinden, das wiederholt während der vier Wochen erfasst wurde (Allcott u. a. 2020).
Ein kurzes Fazit
Menschen nutzen Medien aus den unterschiedlichsten Gründen und machen dabei positive ebenso wie negative Erfahrungen, die sich auf ihr Wohlbefinden auswirken können. Auch wenn diese Auswirkungen im Allgemeinen eher klein ausfallen mögen, können sie bei Einzelnen je nach individuellen Veranlagungen, Bedürfnissen und situativen Aspekten durchaus einen beträchtlichen Einfluss ausüben. Vor diesem Hintergrund scheint es für die öffentliche ebenso wie für die wissenschaftliche Debatte zielführend, noch differenzierter darauf zu blicken, welche Mediennutzung unter welchen Umständen für welches Individuum welche Effekte haben kann, um dann gegebenenfalls positive Effekte stärken und negativen etwas entgegensetzen zu können.
Anmerkung:
1) Die Autor:innen sind maßgeblich an einem neuen Lehrbuch beteiligt. Digital ist besser?! Psychologie der Online- und Mobilkommunikation wird im Herbst 2023 erscheinen. Der vorliegende Text basiert auf zwei Buchkapiteln der Autor:innen aus diesem Buch: Social Media und Wohlbefinden (Jan-Philipp Stein, Silvana Weber, Fabian Hutmacher und Markus Appel) sowie Geschichten, Unterhaltung und Inspiration (Julia Winkler und Markus Appel).
Literatur:
Allcott, H./Braghieri, L./Eichmeyer, S./Gentzkow, M.: The Welfare Effects of Social Media. In: American Economic Review, 3/2020/110, S. 629–676
Appel, M./Marker, C./Gnambs, T.: Are Social Media Ruining Our Lives? A Review of Meta-Analytic Evidence. In: Review of General Psychology, 1/2020/24, S. 60–74
Ellison, N. B./Steinfield, C. W./Lampe, C.: The Benefits of Facebook „Friends“: Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 4/2007/12, S. 1.143–1.168
Kowalski, R. M./Giumetti, G. W./Schroeder, A. N./Lattanner, M. R.: Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth. In: Psychological Bulletin, 4/2014/140, S. 1.073–1.137
Martela, F./Sheldon, K. M.: Clarifying the Concept of Well-Being: Psychological Need Satisfaction as the Common Core Connecting Eudaimonic and Subjective Well-Being. In: Review of General Psychology, 4/2019/23, S. 458–474
Oliver, M. B./Bartsch, A.: Appreciation as Audience Response: Exploring Entertainment Gratifications Beyond Hedonism. In: Human Communication Research, 1/2010/36, S. 53–81
Oliver, M. B./Raney, A. A./Bartsch, A./Janicke-Bowles, S./Appel, M./Dale, K.: Model of Inspiring Media. In: Journal of Media Psychology, 4/2021/33, S. 191–201
Schemer, C./Masur, P. K./Geiß, S./Müller, P./Schäfer, S.: The Impact of Internet and Social Media Use on Well-Being: A Longitudinal Analysis of Adolescents Across Nine Years. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 1/2021/26, S. 1–21
Vanman, E. J./Baker, R./Tobin, S. J.: The Burden of Online Friends: The Effects of Giving Up Facebook on Stress and Well-Being. In: The Journal of Social Psychology, 4/2018/158, S. 496–508
Yang, C./Brown, B. B./Braun, M. T.: From Facebook to cell calls: Layers of electronic intimacy in college students’ interpersonal relationships. In: New Media & Society, 1/2014/16, S. 5-23

Markus Appel (Foto: Fotostudio Balsereit)
Prof. Dr. Markus Appel ist Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationspsychologie und Neue Medien an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in psychologischen Fragen zur Nutzung und Wirkung von Medien und digitalen Technologien.

Julia Winkler (Foto: privat)
Julia Winkler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Wirkung und Verarbeitung von Geschichten, der Rolle von Emotionen sowie der Klima-und Umweltkommunikation.

Fabian Hutmacher (Foto: privat)
Dr. Fabian Hutmacher ist Postdoc am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit individuellen und kollektiven Prozessen des Erinnerns und der Identitätskonstruktion sowie den Mechanismen kognitiver Informationsverarbeitung.
