Zurück in die Zukunft?
Klassische Wirkungsannahmen und digitale Herausforderungen
Nur selten hat man als Wissenschaftler die Gelegenheit, sich über einen längeren Zeitraum mit einer so grundsätzlichen Fragestellung zu befassen. Eine erste „Zwischenbilanz“ anlässlich einer Tagung vor knapp 20 Jahren (Rössler 1998) gelangte zu der wenig überraschenden Einsicht, dass „das Internet“ nicht „wirkt“. Vielmehr sind es die einzelnen Modi der Onlinekommunikation (damals noch mit heute fast vergessenen Begriffen wie „Usenet“ oder „MUDs“ besetzt), die durchaus unterschiedliche Charakteristika aufweisen; diese wiederum ermöglichen eine Abschätzung, ob und inwieweit klassische Wirkungsmodelle (wie Agenda-Setting oder die Kultivierungshypothese, um nur zwei Beispiele zu nennen) noch Gültigkeit beanspruchen können. Als die zentralen Beschreibungsdimensionen der damals neuen digitalen Medien stachen seinerzeit noch Individualität, Interaktivität und (Multi-) Medialität hervor.
Die Auflösung des Wirkungsbegriffs?
Die Strategie, zunächst die Wirkungsvermutungen hinsichtlich neuer Medienanwendungen mit der Logik der klassischen Ansätze zu erklären zu versuchen, leistet bis heute sinnvolle Erklärungsbeiträge: Die Netzwerkeffekte viraler Twitter-Botschaften lassen sich etwa nach wie vor gut mit den Mechanismen der Diffusionsforschung (Karnowski 2017) beschreiben oder die Strukturen in sozialen Netzwerken mithilfe des Meinungsführer-Konzepts (Jäckel 2016, S. 571). Geradewegs unzerstörbar scheint in dieser Hinsicht der Agenda-Setting-Ansatz, dessen so simple wie robuste Ausgangsannahme, wonach die Medien bestimmen würden, worüber ihr Publikum nachdenkt, auch in hybriden Medienwelten aus klassischer und Onlinekommunikation ihre Berechtigung hat. Die Zahl potenzieller Forschungsfragen scheint mit Blick auf Thematisierungsprozesse so unendlich wie die zyklisch, ja, permanent wiederkehrend zu stellende Frage nach der Aufmerksamkeit, die bestimmte Realitätsausschnitte genießen. Gerade hier zeigen empirische Studien sehr schön die Vielfalt an Dynamiken, unterschiedlichen Akteuren und Quellen auf, ebenso wie deren Einfluss auf die individuellen und kollektiven, politischen und lebensweltlichen Agenden (z.B. Neuman u.a. 2014).
Letztere Untersuchung lässt sich u.a. auf den Befund zuspitzen, dass die traditionelle Vorstellung eines kausalen Nachrichtenstroms aufgegeben werden muss – zugunsten einer parallelen Dynamik von Reaktionszeiten auf Journalisten- und Nutzerseite, die einer Netzwerklogik folgt. Diese teilweise Aufhebung der der Wirkungsforschung eigenen linearen Ursache-Wirkungs-Logik führt zurück zum dynamisch-transaktionalen Modell der 1980er-Jahre, das sich als theoretisches Rahmenkonzept besonders gut eignet, um die Effekte digitaler und interaktiver Medien zu strukturieren (Rössler 2015). Werner Früh und Klaus Schönbach, die dieses Modell schon im Lichte wechselseitiger Rückkopplungen zwischen Medien und ihrem Publikum entwickelt hatten, bauten dabei auf Überlegungen auf, die schon seit den 1950er-Jahren rund um die Idee transaktionaler Prozesse entstanden waren; und der ihnen innewohnende „common sense“, dass man Medieneffekte eben nicht nach einem einfachen Reiz-Reaktions-Schema konzipieren könne (Schönbach 2017), scheint im Zeitalter vernetzter Kommunikation umso plausibler. Als größte, zunehmend unlösbare Herausforderung stellt sich dort nämlich die Isolierbarkeit von Ursachen und Folgeerscheinungen (Jäckel 2016, S. 576).
Umso mehr erstaunt, dass ein verdienstvolles und (zu Recht) beliebtes Lehrbuch der Medienwirkungsforschung in seiner gerade erschienenen 6. und überarbeiteten Auflage zwar die klassischen Ansätze mittlerer Reichweite mustergültig abarbeitet, aber bestenfalls sporadisch und nur in kleinen Addenda die Bedeutung des Wandels hin zur Nutzung digitaler, interaktiver Medien mitdenkt (Bonfadelli/Friemel 2017). Dies spiegelt etwa den Stand wider, den ich in einer zweiten Positionsbestimmung, etwa eine Dekade nach der eingangs erwähnten „Zwischenbilanz“, anhand einer systematischen Literaturrecherche berichten konnte: Noch bis 2005 wurde in wissenschaftlichen Studien nicht nur oft unspezifisch von „dem Internet“ und „dem Cyberspace“ gesprochen; auch spielten die klassischen Wirkungsansätze bis dato in gerade 11 % der nationalen und internationalen Forschungsbeiträge eine Rolle (Rössler 2007).
Dieses Bild hat sich seither grundsätzlich verändert, zuletzt besonders auffällig durch die Arbeit der DFG-Forschergruppe „Politische Kommunikation in der Online-Welt“ rund um Gerhard Vowe, die 2016 ihren zentralen Ergebnisband vorlegte (Vowe/Henn 2016). Verschiedene empirische Studien argumentieren hier vor dem Hintergrund altbekannter Ansätze wie Agenda-Setting, Agenda-Building, Gatekeeping, der Schweigespirale, der Wissenskluft-Hypothese oder dem Third-Person-Approach und demonstrieren, wie diese – entsprechend modifiziert – nach wie vor einen wichtigen Erkenntnisbeitrag leisten können. Zuvor hatte sich schon 2013 ein Kompendium der Fachgruppe Rezeptions- und Wirkungsforschung in der DGPuK mit den „Theorieanpassungen in der digitalen Medienwelt“ befasst und dabei eine Reihe dieser Ansätze in die Gegenwart weitergedacht (Jandura u.a. 2013). In diesem Kontext schien es entsprechend auch angebracht, für eine dritte „Zwischenbilanz“ die oben erwähnte Begriffstrias durch die Dimensionen Soziabilität, Visualität und Mobilität zu ersetzen, die zur Beschreibung von Onlinemedien der Generationen 2.0 und höher inzwischen passender erschienen. Als zentrale Konzepte, die im Lichte aktueller Wirkungsprozesse von Belang sind, wurden Selektivität, Glaubwürdigkeit, Vielfalt und Öffentlichkeit identifiziert (Rössler 2013).
Was wir über die Welt wissen, wissen wir aus einem kleinen Bildschirm, der uns sozial, redaktionell und algorithmisch aufbereitete Informationen präsentiert, dabei Sensationalisiertes, Zugespitztes, Radikales tendenziell bevorzugt, was durch die Echokammern der Netzöffentlichkeit selbstverstärkend wirkt.“
Sascha Lobo: Das Ende der Gesellschaft. Von den Folgen der Vernetzung.
Tübinger Mediendozentur 2016
Das zirkuläre Wirkungsfeld
Letzteres spricht ein grundsätzliches, vielleicht das entscheidende Dilemma an, das sich der Medienwirkungsforschung klassischer Prägung aufgrund der neuen Kommunikationsmodi stellt: die Inflationierung von „Medienwirkungen“ als Konsequenz einer medialen Durchdringung nahezu aller Lebensbereiche. In ihrer Abschiedsrede als Präsidentin der ICA beklagte Sonia Livingstone bereits 2008 die scheinbare „mediation of everything“ (Livingstone 2009) und forderte u.a. eine begriffliche Klarheit ein, was sich im Deutschen in der Dualität von Mediatisierung und Medialisierung niederschlägt (Birkner 2017). Dahinter verbirgt sich die immer wieder neu zu stellende Frage nach dem Gegenstand dessen, was man im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Medienwirkungsforschung eigentlich untersuchen will.
In Zeiten, in denen die Grenzen von Öffentlichkeit und Privatheit zunehmend verwischen, muss auch für die Analyse von Medienwirkungen ein zeitgemäßer Zugang gefunden werden. Brosius (2016) schlug hierfür kürzlich ein Modell vor, wonach „die Gesamtheit aller Kommunikationsaktivitäten, die wir beobachten können, öffentliche Kommunikation konstituiert“ (S. 368) und für das einige Zusatzannahmen erforderlich sind, die u.a. das Thema als sinnstiftendes Merkmal und seine Relevanz in den Mittelpunkt der Überlegungen rücken. Das Aufgeben der „Masse“ als konstitutives Element sowohl auf Angebots- wie auf Rezipientenseite (Jäckel 2016, S. 570) diskutierte jüngst auch Christoph Neuberger, der additive, disperse und kopräsente Kollektive unterscheidet. Erschienen in dem insgesamt lesenswerten, von Christian Katzenbach und Christian Pentzold herausgegebenen Sonderheft Theoriearbeit in der Kommunikationswissenschaft zwischen Komplexitätssteigerung und Komplexitätsreduzierung der Zeitschrift „Medien- und Kommunikationswissenschaft“, verdeutlichen seine Überlegungen, dass unter Rückgriff auf die Komplexitätstheorie „die Vielzahl und Vielfalt der Elemente und Relationen, Selbstorganisation und adaptives Handeln der Teilnehmer sowie Eigendynamik und Emergenz der Prozesse in der öffentlichen Kommunikation mit einer großen Zahl von Teilnehmern erfasst“ werden können (Neuberger 2017).
Die allseits wahrgenommene, gestiegene Komplexität in den Kommunikationsbeziehungen unserer Gesellschaft hat auch zur Folge, dass die einstmals klare Unterscheidung zwischen Mediennutzung und Medienwirkung in unserenTheoriemodellen auf den Prüfstand geraten ist. Helmut Scherer spricht sich dafür aus, beides als die Seiten derselben Medaille zu begreifen, die von der Kommunikationsforschung primär aus analytischen Gründen voneinander getrennt wurden (Scherer 2017, S. 145 f.). In anderen Worten: Das „Wirkungsfeld scheint mehr und mehr zirkulär organisiert zu sein“ (Jäckel 2016, S. 576), womit die Selektion sowohl auf Anbieter- als auch auf Rezipientenseite als bestimmender Faktor sowohl für Nutzungs- als auch für Wirkungsmuster in den Fokus der Überlegungen rücken muss. Das Zusammenspiel von für Nutzer maßgeschneiderten („customized“) digitalen Technologien und der selektiven Wahrnehmung („selective exposure“) des Individuums lässt sich dabei modellhaft als ein Zusammenspiel aus personen-, inhalts- und systemzentrierten Faktoren beschreiben (Dylko 2016, bes. S. 395).
Eine spezifische Form dieses Zusammenspiels beflügelt seit einiger Zeit öffentliche wie akademische Diskussionen: die von Eli Pariser formulierte These von der uns umgebenden „filter bubble“, die sich aus einer algorithmengesteuerten Selektion unseres Onlinemenüs ergibt, in die Nutzerdaten ebenso einfließen wie die Softwarevorgaben der Programmierer. Die Konsequenz daraus, dass wir uns nur noch in sich gegenseitig verstärkenden „Echokammern“ bewegen, in denen wir ausschließlich Gleichgesinnte und uns genehme Meinungen antreffen, wird von der Forschung allerdings bislang nicht bestätigt. In den Befunden einer eben veröffentlichten deutschen Mehrmethodenstudie heißt es dementsprechend, „der Anteil algorithmisch gesteuerter Informationen bestimmt das Informationsrepertoire (noch) nicht – oder anders ausgedrückt, der Anteil von Nachrichten, die aus personalisierten Quellen bezogen werden, ist überschaubar. Damit sind die Voraussetzungen für Filterblasen mit Blick auf die Informationsrepertoires bislang nicht gegeben“ (Stark u.a. 2017, S. 187). Auch US-amerikanische Studien, die auf das Nutzungsverhalten von 50.000 Onlinern zurückgreifen konnten, zeigen eher bescheidene Effekte sowohl für als auch gegen den Echokammer-Effekt (Flaxman u.a. 2016).
Ganz deutlich hat sich allerdings die prognostizierte Bedeutung der Glaubwürdigkeit als eine der Schlüsselvariablen in aktuellen Medienwirkungsprozessen erwiesen. Dabei belegen international vergleichende Studien, dass gerade Politiker Twitter bevorzugt als ein Verbreitungsinstrument („broad casting tool“) für ihre Botschaften nutzen – und weniger als Mittel zur Interaktion. Es wird vermutet, dass Politiker auf diese Weise versuchen, für sie unangenehmen, oft auch in unzivilisiertem Ton geführten Diskussionen auszuweichen – und dies, obwohl sie wissen, dass in diesem personalisierten Kontakt gerade die Chance des Kanals liegen könnte (Theocharis u.a. 2016).
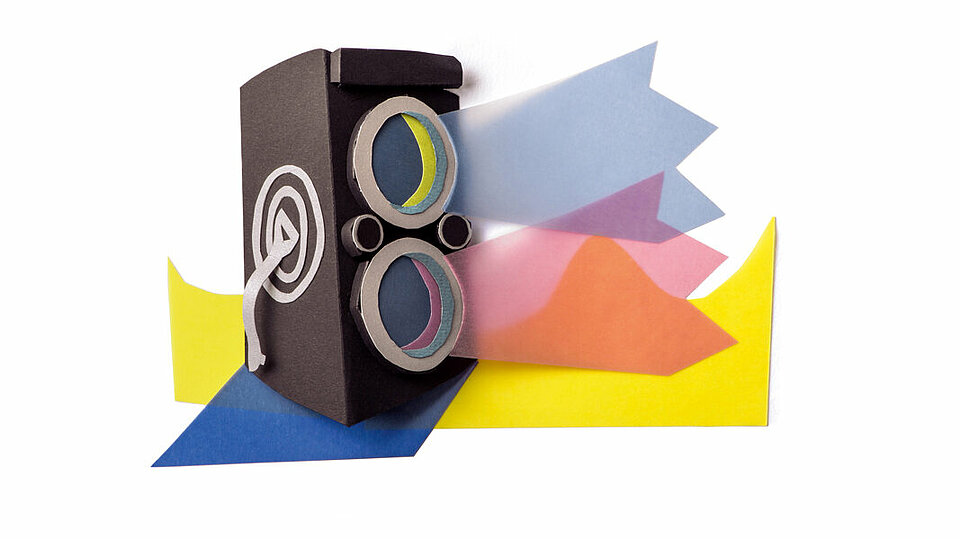
Big Data, Small Data, your data
Digitale Medien dominieren inzwischen das Analyserepertoire aktueller Medienwirkungsstudien, wie es sich auch im „State of the Art“ des Feldes niederschlägt (Rössler 2017). Als eine besondere Herausforderung erweisen sich nach wie vor aber die großen digitalen Datenmengen, wie sie zum einen ohnehin anfallen – etwa als Webseiten-Inhalte, Tweet-Archive oder RSS-Feeds – und zum anderen durch die Onliner als Spuren ihres Nutzungsverhaltens hinterlassen werden, sich als Klicks manifestieren und in Logfiles kristallisieren. Diese massenhaft verfügbaren, maschinell lesbaren und deswegen verschiedenen Analyseverfahren zugänglichen „Beobachtungsdaten“ eröffnen neue Forschungsoptionen, wie sie beispielsweise das Sonderheft Big Data in Communication Research des „Journal of Communication“ (2/2014/64) illustriert. Allerdings sollte das Erkenntnispotenzial aus diesen digitalen Spuren nicht überschätzt werden – wie bei allen Beobachtungsverfahren besteht die Kunst darin, das manifest Erhobene korrekt zu interpretieren. Nicht alle Forschungsfragen lassen sich deswegen sinnvoll mit Big Data bearbeiten.
Umso mehr gilt dies für jene Medieneffekte, die sich auf der Ebene des einzelnen Individuums niederschlagen und auf psychologischen Verarbeitungsprozessen beruhen, mithin für gewöhnlich eher durch Small Data – sprich: Laborexperimente oder qualitative Forschung – untermauert werden. So beleuchtete kürzlich eine Befragungsstudie auf dem Feld der Wirkung von Gewaltdarstellungen in Onlinemedien facettenreich die komplexen Hintergründe der Gewaltrezeption – und zwar jenseits der althergebrachten Frage, ob daraus eigene Gewaltbereitschaft resultiert. Mediennutzer geben vielmehr an, dass sie aus Gewaltdarstellungen u.a. etwas über die soziale Wirklichkeit lernen, sie Empathie für die Opfer von Gewalttaten und Betroffene wie Polizisten oder Soldaten entwickeln oder sie zur Reflexion über das Rollenverständnis von Tätern und Opfern angeregt werden (Bartsch u.a. 2016).
Wie relevant traditionelle Wirkungsannahmen bis heute sein können, lässt sich besonders plastisch am jahrhundertealten „Werther-Effekt“ illustrieren, wonach die medial auffällige Zurschaustellung von Suiziden die Zahl der versuchten und ausgeführten Selbstmorde nach oben treibt. Ähnliche statistische Zusammenhänge wurden zuletzt wieder im Zusammenhang mit der über den digitalen Abrufdienst Netflix verbreiteten Serie Tote Mädchen lügen nicht (OT: 13 Reasons Why) ermittelt: Eine Zeitreihenanalyse amerikanischer Google-Trends-Daten (Big Data) ergab, dass die Suchanfragen nach „suicide“ in den rund drei Wochen nach der Bereitstellung der Serie kumuliert um 19 % (oder circa eine Mio. Anfragen) angestiegen waren (Ayers u.a. 2017). Darunter waren allerdings auch Suchen nach Präventionsmaßnahmen und Hilfe-Hotlines – und nicht nur nach Handlungsanweisungen. Auch für Deutschland hat mit der Veröffentlichung der Serie im Jahr 2017 eine erhöhte Nachfrage nach Beratung eingesetzt, wie die FSF auf ihrer Website diskutiert (Keller 2017). Die jugendpsychiatrischen Vereinigungen des Landes haben deswegen in einer gemeinsamen Stellungnahme Lehrer und Eltern dazu aufgerufen, die Serie mit den Kindern in einem geschützten Setting anzusehen, sie raten psychisch labilen und vulnerablen jungen Menschen dringend vom Konsum der Serie ab (DGKJP/DGPPN 2017). Angeblich haben zwei Schülerinnen in Oberösterreich versucht, sich nach dem Serienvorbild zu töten, wie die „Passauer Neue Presse“ im Mai 2017 berichtete (PNP 2017). Auch wenn es dafür keines derart drastischen Belegs bedurft hätte: Die Medien wandeln sich, manche Wirkungsmuster kehren wieder.
Klaus Schönbach schrieb 1997 in einem Essay für die „Publizistik“ von der „Illusion eines hyperaktiven Publikums“ und sah auch 2004 noch keinen Grund, diese denkwürdige Sprachfigur zurückzunehmen (Schönbach 1997; 2004). Bis heute spielt der „passive“ Medienkonsum eine wichtige Rolle, egal ob die Berieselung von der Mattscheibe oder aus Videoplattformen herabregnet – und die pure Interselektivität, die das Surfen erfordert, unterscheidet sich inzwischen nur noch graduell vom Zappen mit der Fernbedienung. Aber dennoch: In die jüngere Generation, die schon Schönbach als potenzielle Kandidaten für einen Nutzungswandel identifiziert hatte, ist in den vergangenen 13 Jahren Bewegung geraten. Die Eigenproduktion von Inhalten ist selbstverständlicher denn je, ob ein flüchtig dahingeworfener Kommentar unter einem Artikel auf „Spiegel online“ oder der Tweet von unterwegs, das Foto vom Mittagessen für die Facebook-Timeline bis hin zu den Millionen Blogs, Podcasts und YouTube-Kanälen; ein Jahrzehnt nach dem Aufruf „Broadcast yourself“ gehören „YouTuber“ und „Influencer“ zu den angesagten Berufswünschen der Digital Natives. Für die Medienwirkungsforschung stellt sich hier einmal mehr die ethische Frage, ob all das, was online beobachtbar ist (und damit den Brosius’schen Öffentlichkeitsbegriff von oben erfüllt) tatsächlich auch von der Sozialwissenschaft beobachtet werden soll. Denn so verstörend es uns auch vorkommen mag: Das bereitwillige Teilen intimster Posts und Fotos auf dem persönlichen Facebook-Account schließt nicht automatisch die „informierte Einwilligung“ („informed consent“) ein, dass ein Medienwirkungsforscher diese Angaben beobachten, sammeln und auswerten darf.
Literatur:
Ayers, J. W./Althouse, B. M./Leas, E.C./Dredze, M./Allem, J.P.: Internet Searches for Suicide Following the Release of 13 Reasons Why. In: JAMA Intern Med., Juli 2017. Abrufbar unter: http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2646773 (letzter Zugriff: 03.09.2017)
Bartsch, A./Mares, M.-L./Scherr, S./Kloß, A./Keppeler, J./Posthumus, L.: More Than Shoot-Em-Up and Torture Porn: Reflective Appropriation and Meaning-Making of Violent Media Content. In: Journal of Communication, 66/2016, S. 741-765
Birkner, T.: Medialisierung und Mediatisierung. Baden-Baden 2017
Bonfadelli, H./Friemel, T.N.: Medienwirkungsforschung. Konstanz 20176
Brosius, H.-B.: Warum Kommunikation im Internet öffentlich ist. In: Publizistik, 61/2016, S. 363-372
DGKJP/DGPPN: Gemeinsame Stellungnahme von DGKJP und DGPPN zur TV-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“. Warnung: „Tote Mädchen lügen nicht“ könnte Suizide auslösen. Abrufbar unter: http://www.dgkjp.de/aktuelles1/446-gemeinsamestellungnahme-von-dgkjp-und-dgppn (letzter Zugriff: 03.09.2017)
Dylko, I. B.: How Technology Encourages Political Selective Exposure. In: Communication Theory, 26/2016, S. 389-409
Flaxman, S./Goel, S./Rao, J.M.: Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption. In: Public Opinion Quarterly, 80/2016, S. 298-320
Jäckel, M.: Wirkungsforschung: Auf der Suche nach den Ursachen. In: Media Perspektiven, 11/2016, S. 569-577
Jandura, O./Fahr, A./Brosius, H.-B. (Hrsg.): Theorieanpassungen in der digitalen Medienwelt. Baden-Baden 2013
Karnowski, V.: Diffusionstheorien. Baden-Baden 20172
Keller, L.: Selbstmord in Serie. In: FSF-Blog, 16.05.2017. Abrufbar unter: http://blog.fsf.de/panorama/bildrauschen/selbstmord-in-serie/2017/05 (letzter Zugriff: 03.09.2017)
Livingstone, S.: On the mediation of everything: ICA presidential address 2008. In: Journal of Communication, 59/2009, S. 1-18
Neuberger, C.: Die Rückkehr der Masse. Interaktive Massenphänomene im Internet aus Sicht der Massen- und Komplexitätstheorie. In: Medien & Kommunikationswissen schaft, 65/2017, S. 550-572
Neuman, W. R./Guggenheim, L./Jang, S. M./Bae, Y.S.: The Dynamics of Public Attention: Agenda-Setting Theory Meets Big Data. In: Journal of Communication, 64/2014, S. 193-214
PNP [Kürzel]: Wie in einer Serie: Schülerinnen wollten sich das Leben nehmen. In: Passauer Neue Presse, 19.05.2017. Abrufbar unter: http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2517012_Wie-in-der-Serie-Oesterreichische-Schuelerinnenplanen-Suizid.html (letzter Zugriff: 03.09.2017)
Rössler, P.: Wirkungsmodelle: die digitale Herausforderung. Überlegungen zu einer Inventur bestehender Erklärungsansätze der Medienwirkungsforschung. In: Ders. (Hrsg.): Online-Kommunikation. Beiträge zu Nutzung und Wirkung. Opladen 1998, S. 15-46
Rössler, P.: Wirkungsmodelle: die digitale Herausforderung revisited. Forschungsstand zu Wirkungen von Online-Kommunikation – ein rückblickender Essay. In: S. Kimpeler/M. Mangold/W. Schweiger (Hrsg.): Die digitale Herausforderung. Zehn Jahre Forschung zur computervermittelten Kommunikation. Wiesbaden 2007, S. 91-103
Rössler, P.: Soziabilität, Visualität, Mobilität. Online-Kommunikation als permanente Herausforderung der Medienwirkungsforschung. In: O. Jandura/A. Fahr/H.-B. Brosius (Hrsg.): Theorieanpassungen in der digitalen Medienwelt. Baden-Baden 2013, S. 51-70
Rössler, P.: Dynamisch-transaktional modellieren heute. Zur Relevanz eines klassischen kommunikationswissenschaftlichen Theorie-Rahmenkonzeptes im Kontext medialer Innovationen. In: H.-J. Stiehler u.a. (Hrsg.): Inspiration und Systematik. Leipzig 2015, S. 48-82
Rössler, P. (Hrsg.): The International Encyclopedia of Media Effects, 4 Bände. Chichester 2017
Scherer, H.: Connecting Media Use to Media Effects. In: P. Rössler (Hrsg.): The International Encyclopedia of Media Effects, Band 3. Chichester 2017, S. 137-148
Schönbach, K.: Das hyperaktive Publikum: Essay über eine Illusion. In: Publizistik, 42/1997, S. 279-286
Schönbach, K.: Das hyperaktive Publikum – noch immer eine Illusion. Ein Essay, „revisited“. In: C. zu Salm (Hrsg.): Zaubermaschine interaktives Fernsehen? TV-Zukunft zwischen Blütenträumen und Businessmodellen. Wiesbaden 2004, S. 113-120
Schönbach, K.: Media Effects: Dynamics and Transactions. In: P. Rössler (Hrsg.): The International Encyclopedia of Media Effects, Band 3. Chichester 2017, S. 974-983
Stark, B./Magin, M./Jürgens, P.: Ganz meine Meinung? Informationsintermediäre und Meinungsbildung – Eine Mehrmethodenstudie am Beispiel von Facebook. Düsseldorf 2017
Theocharis, Y./Barberá, P./Fazekas, Z./Popa, S.A./Parnet, O.: A Bad Workman Blames His Tweets: The Consequences of Citizens’ Uncivil Twitter Use When Interacting With Party Candidates. In: Journal of Communication, 66/2016, S. 1007-1031
Vowe, G./Henn, P. (Hrsg.): Political Communication in the Online World: Theoretical Approaches and Research Designs. New York/London 2016

